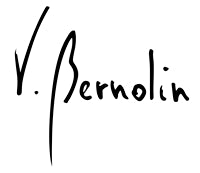Die Herstellung von Flöten

Teilen
Die Anforderungen der Flötisten sind in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen und haben die Instrumentenbauer zu deutlichen Verbesserungen gezwungen. Schnelle Ansprachen in den hohen Lagen, kraftvolle Bässe, Korrektheit und eine raffinierte Klangfarbe sind heute unabdingbar, um ein Instrument von hoher Qualität zu bauen.
Der Instrumentenbau ist eine spannende, aber auch zeitraubende Aktivität, die viel Disziplin erfordert. In meiner rationellen und gut ausgestatteten Werkstatt kann ich Instrumente mit großer Flexibilität herstellen und ich kann problemlos von der Herstellung eines Ganassi zu einer barocken Sopranistin wechseln.
Ich kontrolliere verschiedene Aspekte meiner Arbeit mit verschiedenen optischen Instrumenten, die von der Uhrmacherlupe bis zum Stereomikroskop reichen.
Die Schärfe der Schnittkanten, die Oberflächenbeschaffenheit, die Porosität der verschiedenen Holzarten... all diese Details erscheinen in einem ganz anderen Licht. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich an den Geigenbau herangehe.
Nichts wird dem Zufall überlassen, sei es die Marke der Schleifmittel, die ich verwende, die Eintauchzeit in die trocknenden Öle, die Stahlsorte meiner Werkzeuge, die Schleifverfahren usw. ... alles wird getestet, kontrolliert und regelmäßig hinterfragt.
Der Entwurf des Instruments ist die erste Phase.
Die Blockflöte hat im Laufe ihrer Geschichte eine Vielzahl von Griffweisen und Stimmungen erlebt. Aus praktischen Gründen werden heute am häufigsten die Stimmungen 415 und 442 Hz verwendet. Die Stimmung 466 wird hauptsächlich für Renaissance-Consort-Flöten und für ein spezielles Repertoire verwendet. Die gebräuchlichsten Griffweisen sind die moderne Griffweise, die als englischer Barock bezeichnet wird, die alte Griffweise oder Hottetere und die Ganassi-Griffweise, die der alten Griffweise in den ersten eineinhalb Oktaven ähnelt.
Diese Vielfalt an Griffweisen und originalen Stimmungen zwingt den Instrumentenbauer dazu, die historischen Modelle anzupassen. Einige wurden von den Instrumentenbauern sorgfältig vermessen und gezeichnet. Insbesondere Fred Morgan hat uns äußerst interessante, präzise und sehr detaillierte Pläne hinterlassen.

Die Anpassung an die Stimmgabel erfolgt über sehr einfache homothetische mathematische Beziehungen. Sie führt jedoch zu einer unvermeidlichen Veränderung der Klangfarbe des Instruments.
Oft muss auch der Fingersatz angepasst werden. Die moderne Griffweise, die fälschlicherweise als Barock bezeichnet wird, ist heute zur Norm geworden. Die Blockflöte hat in ihrer Geschichte schon oft ihre Griffweise geändert, war es also notwendig, eine neue zu erfinden? Ich wünschte, es wäre bei der Hottetere-Griffweise geblieben, die es ermöglicht, auf Instrumenten zu spielen, die den Originalen näher sind, aber die moderne Griffweise ist heute so weit verbreitet, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie jemals aufgegeben wird.
Manchmal muss der Tonumfang vergrößert werden, wie bei der Ganassi-Flöte oder den Renaissanceflöten. Sylvestro Ganassi fügte seiner Abhandlung eine Grifftabelle für eine Flöte mit einem sehr großen Tonumfang bei. Es scheint daher legitim, dass die Musiker eine Flöte mit diesem Tonumfang verlangen. Diese Flöte wird jedoch in den folgenden Diminutionsbeispielen nicht vollständig genutzt, was darauf schließen lässt, dass sie nicht mit ausreichender Leichtigkeit spielbar war. Daher wurden die Flötenbauer dazu veranlasst, die Flöte über zweieinhalb Oktaven nutzbar zu machen, was jedoch historisch nicht gerechtfertigt ist.
Ein weiteres Problem ist die Temperierung. Unsere modernen Ohren haben sich an die Homogenität der gleichstufigen Temperierung gewöhnt, aber die ungleichstufigen Temperierungen verleihen den Instrumenten eine ganz besondere Farbe und Ausdruckskraft, selbst wenn sie solo gespielt werden. Das elektronische Stimmgerät ist ein wertvolles Werkzeug, um diese Temperierungen durchzuführen, aber es muss mit Vorsicht behandelt werden.
Ich möchte mich an dieser Stelle an alle Flötisten wenden, denen ich empfehle, dieses ausgezeichnete Werkzeug mit Bedacht einzusetzen. Durch den Gebrauch dieses Instruments wurden die Blockflötenbauer gezwungen, sich immer mehr der gleichmäßigen Temperierung anzunähern, die für eine Blockflöte jedoch kaum von Interesse ist. Bei einer perfekt gestimmten Flöte können Abweichungen von 35 Cent zwischen zwei Noten (z.B. Cis und Eb) auftreten....der mesotonischen Temperierung. Die bekannteste und moderateste Temperierung ist die Valotti-Temperierung, die ich Ihnen für Barockinstrumente empfehle, wenn Sie noch kein Experte sind.
Nach dem Entwurf folgt die eigentliche Herstellung.
Die verwendeten Hölzer müssen mindestens 4-5 Jahre getrocknet sein, wenn möglich noch länger. Ideal ist es, wenn Sie über einen Vorrat verfügen, der von einem vorausschauenden Verwandten geschnitten oder gekauft wurde... Dies war bei mir der Fall, da mein Vater in den Jahren 1975 bis 1980 einen Vorrat an Buchsbaum, Ahorn, Birne, Grenadill, Palisander und Bubinga angelegt hatte. Natürlich fülle ich diesen Vorrat regelmäßig auf, um in Zukunft nicht zu kurz zu kommen.
Aber die Dauer des Trocknens reicht nicht aus. Ich lege besonderen Wert darauf, dem Holz zwischen den verschiedenen Phasen der Herstellung einige Monate Ruhe zu gönnen: Rohling, Bohren, Drechseln und Fertigstellung sind Arbeitsgänge, die zwei bis drei Monate auseinander liegen können. Buchsbaumholz wird einer speziellen Behandlung unterzogen: Es wird in heißes Öl getaucht, um die Trocknung zu vervollständigen und innere Spannungen, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben, zu beseitigen.
Der Schnitt erfolgt mit einer Bandsäge. Bereits in diesem Stadium wird eine sorgfältige Auswahl der Stücke getroffen.
Die Ecken werden vor dem Wenden abgeschlagen.


Das Bohren ist der nächste Arbeitsschritt. Um eine bessere Zentrierung zu ermöglichen, wird das Holzstück gedreht und der Bohrer bleibt fest. Ein erstes, zylindrisches Loch wird mit einem Werkzeug mit hohem Materialabtrag, z. B. einem Luftbohrer, gebohrt.

Diese Art von Werkzeug ermöglicht ein präzises Bohren ohne Hitzeentwicklung, da der Span während des Vorschubs durch Druckluft abgeführt wird.
Die Endbearbeitung erfolgt mit einem speziellen Schneidwerkzeug, das „Reibahle“ genannt wird. Im Gegensatz zum herkömmlichen Spiralbohrer, der an seinem Ende schneidet und daher nur ein zylindrisches Loch herstellen kann, hat die Reibahle eine Schneidkante über die gesamte Länge, wodurch ein konisches Loch mit einem ausgezeichneten Finish erzeugt werden kann. Die Reibahle reproduziert ihre eigene Form im Inneren der Bohrung, so dass es möglich ist, eine komplexe Bohrungsform zu erhalten. Sie benötigen für jede Bohrungsform eine eigene Reibahle. Reibahlen sind sehr wichtige Werkzeuge, die speziell für den Holzblasinstrumentenbau entwickelt wurden.
Ich fertige meine eigenen in meiner Werkstatt an, wo sie auf einer hochpräzisen CNC-Drehmaschine gedreht werden. Die Schnitte werden mit einer Fräsmaschine geschnitten, eine Maschine, die in einer Werkstatt gute Dienste leistet.


Das Ergebnis ist ein Rohling, der dem Endziel sehr nahe kommt und an dem ich mit einer guten Ausgangsbasis arbeiten kann.

Das Polieren und Färben verleiht jedem Instrument einen einzigartigen Charakter. Nacheinander werden immer feinere Schleifmittel (bis zur Körnung 1200) aufgetragen, und das Stück wird mit einer Polierpaste fertiggestellt. Das Endergebnis hängt zum Teil davon ab, wie scharf die Werkzeuge sind, die zum Drehen verwendet wurden.
Einfach geformte Flöten wie Ganassi und Rafi können mit Schellack „französisch“ lackiert werden, besonders wenn sie aus hellem Holz sind und nicht gebeizt wurden. Flöten mit komplexeren Formen wie Barockflöten oder aus dunklerem Holz wie Grenadill werden einfach poliert.
Die Flöte wird in jedem Fall mit Leinöl behandelt, um ihre akustischen Eigenschaften zu verbessern und den Feuchtigkeitsaustausch mit der Außenwelt zu begrenzen. Die Färbung erfolgt auf traditionelle Weise, u.a. mit Salpetersäure, nach einem strengen Vorbereitungs- und Nachbehandlungsverfahren. Diese Art der Färbung hat einen außergewöhnlichen Widerstand über die Zeit gezeigt, da historische Instrumente auf diese Weise gefärbt wurden.
Das Licht wird auf einer Fräsmaschine geschliffen, wobei der Kopf der Flöte auf einer speziellen Halterung gehalten wird.

Ich verfüge über eine gesteuerte 4-Achsen-Fräsmaschine, mit der ich verschiedene Arbeitsschritte durchführen kann, darunter auch das Bohren der Löcher im Korpus. Zwar ist die Maschine für diesen Arbeitsgang überqualifiziert, aber sie hat den Vorteil, dass sie eine hohe Präzision bietet, vor allem in der Winkelstellung. Andernfalls zeichnet man sorgfältig an und verwendet eine herkömmliche Bohrmaschine.
Mit dieser Maschine kann ich auch hervorragende Blockrohlinge für die gängigsten Modelle bearbeiten.
Das Ergebnis ist hervorragend, vor allem, weil es keine Grate gibt.

Von diesem Zeitpunkt an gibt man Drehbänke, Bohrmaschinen und andere Maschinen auf. Dies ist der größte Teil der Arbeit, was die Zeiterfassungen für die Herstellung betrifft, und auch der interessanteste. Er wird an meinem Schreibtisch mit sehr einfachen traditionellen Werkzeugen ausgeführt.
Die Abschrägung (Labium) wird von Hand mit einem Stechbeitel und speziellen Werkzeugen fertiggestellt.


Er wird genau in den Flötenkopf eingepasst, damit er ohne Kraftaufwand und mit perfekter Abdichtung ineinandergreifen kann.

Das Skalpell wird auch verwendet, um die Löcher im Korpus und im Schallbecher zu erweitern, was eine der Methoden ist, die Flöte zu stimmen.
Einige Holzarten sind in den ersten Lebensstunden des Instruments recht feuchtigkeitsempfindlich und erfordern viele Nachbesserungen, bevor das Holz seinen Platz eingenommen hat und stabilisiert ist.
Einige Aspekte können objektiv beurteilt werden: die Gewandtheit in den hohen Lagen, die Stabilität der tiefen Lagen, die Stimmung.... Aber der Klang, die Leichtigkeit, mit der die musikalische Absicht ausgedrückt werden kann und der Spielkomfort sind viel subjektivere Aspekte des Instruments. In diesem Moment wird die Arbeit des Flötenbauers wirklich künstlerisch, wenn er den Klang und die Persönlichkeit der Flöte formt. Die Einstellung des Mundstücks ist eine sehr feine Arbeit, die Feingefühl und Zeit erfordert.
Die Flöte wird viele Male gespielt, ausprobiert und nachbearbeitet, bis sie zu einem einzigartigen Instrument wird, das den musikalischen Ausdruck erleichtert und dem Spieler Freude am Spiel bereitet.