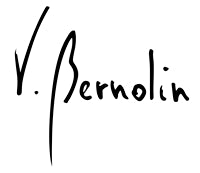Charakterisierung von Blockflöten

Teilen
Jeder hat es schon einmal erlebt: Es ist sehr schwierig, die Erfahrung mit einem Instrument in Worte zu fassen, weil die Empfindungen so sehr mit den Gefühlen verbunden sind, die man empfindet, und mit dem Mangel an Neutralität, der unweigerlich damit einhergeht. In diesem Artikel möchte ich versuchen, die verschiedenen Aspekte des Klanges und der Ansprache einer Blockflöte zu beschreiben, und zwar nicht nur anhand der Empfindungen, sondern auch anhand meiner Erfahrungen als Postbote und der physikalischen Komponenten, die ich mit dem Gehörten in Verbindung bringen kann. Als physikalische Komponenten bezeichne ich die verschiedenen konkreten Größen, wie das Profil oder die Breite des Windkanals, die Größe und den Winkel der Austrittsfasen, die Dicke des Labiums, seine relative Position im Fenster oder jede andere messbare Größe, die die Pfeifeneinstellung charakterisieren könnte. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er es ermöglicht, bestimmte Aspekte der Funktionsweise des Instruments zu differenzieren, die ohne diese Unterstützung schnell zu Verwirrung führen würden. Aus diesem Grund bitte ich den Leser, offen zu sein und zu verstehen, dass die von mir erwähnten Elemente nicht nur meiner Phantasie oder subjektiven Wahrnehmung entspringen, sondern mit einer Reihe von physikalischen Parametern verbunden sind, die dieser Analyse eine gewisse Legitimität verleihen.
Die Kombination Flexibilität und Widerstand:
Wird definiert als die Möglichkeit, die Klangfarbe und die Intonation zu variieren, indem man den Luftdruck, der in die Pfeife eintritt, anpasst. Widerstand wird hier als Synonym für Stabilität verwendet. Bei einer flexiblen Blockflöte ändert sich der Klang mit dem Druck, während eine widerstandsfähige Blockflöte die Schwankungen mit größerer Stabilität abfedert und verkraftet. Hier kommt es auf die richtige Dosierung an: Eine sehr widerstandsfähige Flöte kann die musikalische Absicht mit einem starren Klang unterdrücken, eine zu flexible Einstellung kann jedoch zu beweglich und instabil sein, sodass die gewünschte Expressivität nicht mit der Intonation vereinbar ist. Eine stabilere Einstellung bietet darüber hinaus einen solideren Bass.
Die Obertöne
Dies ist möglicherweise einer der am wenigsten verstandenen Aspekte des Klangs von Musikinstrumenten und zweifellos auch der am schwierigsten zu definierende. Den interessantesten Instrumenten wird oft fälschlicherweise zugeschrieben, sie seien reich an Obertönen. Und doch ist dieser Reichtum in der Physik und Akustik eindeutig mit einem lauten Instrument verbunden, mit einem banalen und gewöhnlichen Klang ohne jeden Charme. Im Gegenteil: Erst die Beherrschung der Emission bestimmter Obertöne ermöglicht die Erzielung der gewünschten Klangfarbe und kann nicht das Ergebnis des Zufalls sein. Zu meiner großen Überraschung stellte ich fest, dass manche Musiker dem kaum Beachtung schenken, nicht mehr als manche Hersteller. Dies ist zweifellos das subjektivste Element dieser Studie, aber es ist auch das Element, bei dem ich keine Kompromisse eingehen kann.
Die Angriffe
Die Geschwindigkeit der Angriffe bestimmt die Reaktionsfähigkeit des Instruments. Wie bei der Flexibilität muss auch hier sorgfältig überlegt und dosiert werden: Zu viel Reaktionsschnelligkeit macht die Flöte zart und charaktervoll, zu viele langsame Angriffe wirken träge und überfordern den Flötisten.
Die Eröffnung
Wird die Präzision und Reinheit des Klangs definieren, die zu einer bestimmten Zeit angestrebt wurden, insbesondere in den 70er und 80er Jahren mit den Flöten von Fred Morgan. Inzwischen hat man erkannt, dass offenere Blockflöten einen weicheren, weniger glänzenden, wärmeren Klang mit einem weniger durchdringenden, aggressiven zweiten Register haben. Diese Richtung wurde seit den 2000er Jahren von der aufstrebenden Generation von Blockflötisten eingeschlagen, insbesondere von Dorothée Oberlinger, Erik Bosgraaf und Maurice Steger. Diese Art der Einstellung erfordert mehr Luftdurchsatz, und übermäßig offene Flöten können schwer zu spielen sein. Daher ist auch hier ein Kompromiss erforderlich.
Die Transienten
Angriffe werden in der Akustik als „Transienten“ bezeichnet und sind vor allem auf einigen Orgelpfeifen und Consort-Blockflöten zu hören. Markierte Übergänge sind dynamisch, da sie eine perkussive und rhythmische Wirkung haben. Andererseits können diese Angriffe die sehr schnellen Striche und Übergänge stören, die man in der Barockmusik, insbesondere in den Konzerten von Vivaldi, häufig findet. Aus diesem Grund behalte ich markante Angriffe für Renaissance-Blockflöten oder Volksmusik vor und bevorzuge diskretere Übergänge für Barockinstrumente, bei denen ich eine klarere Spielweise für notwendig erachte.
Das Diagramm:
Unten finden Sie ein Diagramm, das die von mir genannten Punkte zusammenfasst. Sie werden feststellen, dass ich die beiden Extreme jedes Punktes gegenübergestellt habe, um die Aussage besser zu veranschaulichen. Dieses Diagramm ist für mich nützlich, um den Einfluss jedes Parameters zu charakterisieren, den ich mit seinem Einflussbereich vergleiche. Es ist nicht dazu gedacht, ein Instrument zu kartographieren, wie Sie weiter unten sehen werden.

Es folgt eine andere Art von Diagramm, in dem die oben genannten Elemente mit Noten von 0 bis 5 bewertet werden. Diese Skala ist zwar nicht unumstritten, insbesondere bei den Transienten, bei denen eine 5 nicht unbedingt die beste Note ist, aber sie ermöglicht ein besseres visuelles Verständnis der Art der vorgeschlagenen Einstellung. Wie Sie sehen werden, wird der Vergleich zwischen den Instrumenten durch diese Art der grafischen Darstellung erheblich erleichtert.
Offene oder flexible Flöten: Ernst Meyer und Fred Morgan
In den 70er und 80er Jahren fand Fred Morgan, wie oben erwähnt, einen Konsens mit einer recht wenig offenen Abstimmung, einem reinen und präzisen Klang, viel Flexibilität und Geschmeidigkeit im Klang, sehr schnellen und leichten Höhen und einem wenig kräftigen Bassbereich.

Im Gegensatz dazu bietet Ernst Meyer in den 2000er Jahren den Flötisten eine sehr offene Einstellung mit einem wärmeren und warmen Klang, kräftigen und sehr stabilen Bässen, wobei im Gegenzug ein hohes Register extrem energische Angriffe und eine hohe Luftgeschwindigkeit erfordert.
Wie schneiden Bernolin-Flöten im Vergleich ab?
Widerstand: Ich halte es für notwendig, dem Musiker einen gewissen Spielraum und dem Instrument tatsächlich eine gewisse Flexibilität zu lassen, aber ich achte insbesondere darauf, dass in den mittleren Tönen keine Sättigung auftritt und der Bass solide ist.
Harmonik: Eleganz wird immer der rote Faden meiner Arbeit sein. Mein Ziel ist es, möglichst viele außergewöhnliche Instrumente herzustellen.
Eröffnung: Die Einstellung, die ich heute vornehme, ist eher offen, aber ich bin mir der pneumatischen Grenzen der menschlichen Maschine bewusst und der erforderliche Luftstrom bleibt angemessen und zugänglich.
Attacken: Ich gehe eindeutig in die Richtung eines reaktiven Instruments mit eher schnellen Angriffen. Ich betrachte dies als einen Vorteil in Bezug auf die Spielbarkeit. Im Gegenzug ist die Luftgeschwindigkeit bei Angriffen in den tiefen Lagen und bei strukturell heiklen Noten wie dem hohen C # der Altblockflöte zu kontrollieren. Ich bin nach wie vor von der Spielbarkeit und den musikalischen Möglichkeiten, die dieser Ansatz bietet, überzeugt.
Transienten: Bei den Ganassi- und Van Eyck-Flöten sind die Übergänge stärker ausgeprägt, während ich bei den Barockflöten mehr Flexibilität in der Artikulation bevorzuge. In jedem Fall sollte das Transienten nicht zu einer Belastung für den Musiker werden oder den musikalischen Diskurs verwischen.


Sie werden mein Bemühen um Homogenität und Ausgewogenheit bemerken, ohne dass die Eleganz darunter leidet.